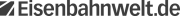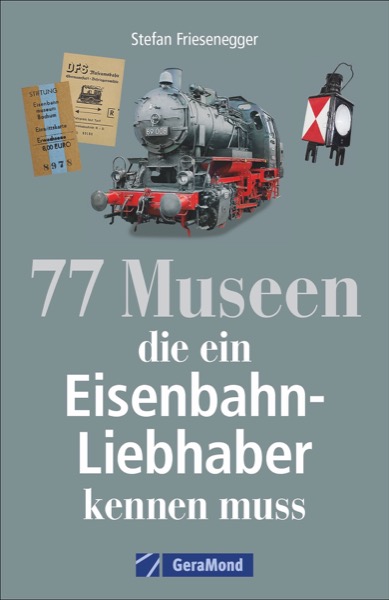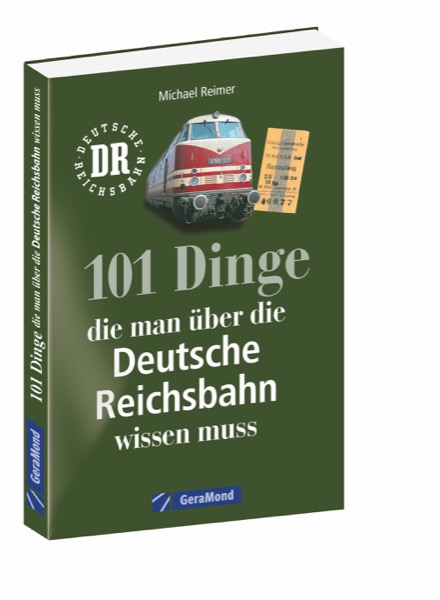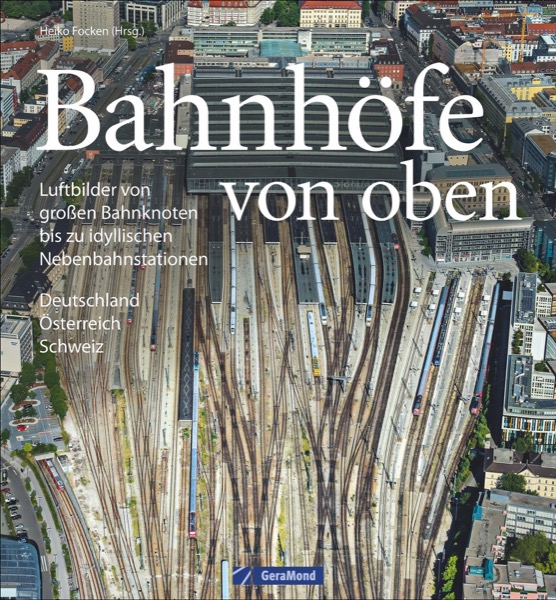Die paar Kummerfalten – doch der Abschied naht
 © Thomas Feldmann
© Thomas FeldmannVier Grundtypen müssen genügen
Unter dem Arbeitstitel E 46 wurde die Entwicklung der Prototypen begonnen, die dann unter der Baureihenbezeichnung E 10 gebaut und ab 1952 ausgeliefert wurden. Schnell wurde klar, dass allein zwei Ellok-Typen mit unterschiedlicher Übersetzung nicht ausreichen würden, um allen Leistungsanforderungen gerecht zu werden.
Somit wurden nun die Schnellzuglok E 10, die Güterzuglok E 40, die Nahverkehrslok E 41 und die schwere Güterzuglok E 50 entwickelt und gebaut. Die E 40 unterschied sich zunächst von der E 10 lediglich durch eine geänderte Getriebeübersetzung, fehlende elektrische Bremse sowie natürlich geringere Höchstgeschwindigkeit, eine andere Lackierung und höhere Anfahrzuglast.
Ihre Höchstgeschwindigkeit betrug anfangs 100 km/h, was im mittelschweren Güterzugdienst ausreichend war. Im Juni 1969 wurde diese jedoch auf 110 km/h erhöht, um die Loks flexibler, z. B. auch im Personenzugverkehr, einsetzen zu können. Die letzte Serie (Baureihe 140.8) erhielt dazu eine Ausrüstung für Wendezugbetrieb und Doppeltraktion. Weitere Besonderheiten und Entwicklungen sind im Kasten rechts aufgeführt.
Eine Unterbauart der E 40 stellt die Baureihe 139 dar. Elf Lokomotiven der Baureihe 140 wurden ab 1959 für den Einsatz auf den Steilstrecken Erkrath – Hochdahl, Altenhundem – Welschen-Ennest und der Höllentalbahn vorgesehen und dazu mit einer Gleichstrom-Widerstandsbremse ausgerüstet. Zunächst wurden so E 40 131 – 137 und die E 40 163 – 166 ab Werk mit dieser E-Bremse ausgestattet. Die Loks wurden ab 14. Juni 1961 als E 4011 bezeichnet (analog zur E 44 mit Zusatzbremssystem) und ab E 40 1131 eingeordnet. Mit Umstellung der Loknummern im Jahr 1968 auf EDV-Verarbeitung wurden alle E 4011 in die Baureihe 139 umgezeichnet. Weitere 20 Lokomotiven (139 309 – 316 und 139 552 – 563) aus der laufenden Produktion der 140 folgten.
Nach dem Ende der Einsätze im Höllental (Ablösung durch die Baureihe 143) zog die DB die Loks aus ihrer langjährigen Heimat Offenburg ab und in München zusammen. Dort erbrachten sie Leistungen vor Personenzügen u. a. zwischen Tutzing und Kochel sowie vor der „Rollenden Landstraße“. Sie gelangten aber auch im Mischeinsatz mit der Baureihe 140 in gemeinsamen Plänen nach Österreich und bis zum Brenner. Anfang der 1990er-Jahre wurden aufgrund des gestiegenen Bedarfes an Loks für Berg- und Steilstrecken und zeitgleicher Drehgestellschäden an Maschinen der Baureihe 110 dank der Einheitsbauweise weitere 139er durch Umbauten hergestellt. Hierzu nahm man den Lokkasten der Baureihe 110, die serienmäßig mit einer E-Bremse ausgeliefert worden waren, und tauschte die Drehgestelle mit ausgemusterten Drehgestellen der Reihe 140. Damit ergaben sich nun die folgenden „neuen“ 139er: 122, 139, 145, 157, 172, 177, 213, 214, 222, 246, 250, 255, 260, 262, 264, 283, 285, 287. Die Baureihe 139 wurde dann wie auch die Baureihe 140 dem Geschäftsbereich DB Cargo (später Railion und DB Schenker) zugewiesen.
Eine neue „Weiße Lady“ und „Zebras“
Daneben gab es aber auch einen Rückbau: So wurde 139 134 als Ersatz für die nach einem Unfall ausgemusterte 110 477 in die 110 511 umgebaut. Diese ist heute immer noch im Bestand und als Mietlok mit einer weißen Sonderlackierung („Weiße Lady“) vom Standort DB Instandhaltungswerk Dessau bundesweit im Einsatz anzutreffen.
Seiten
ET 184 41, 42/ ET 185 01: Elektrische Pioniere
Am 4. Dezember 1895 eröffnete die Localbahn AG in Württemberg zwischen Meckenbeuren und Tettnang die erste elektrische Vollbahn in Europa.
Für den...
weiterBaureihe 140 im Emsland: Die Funken schlagen
Im Emsland tummelten sich früher die Dampflokfans. Doch Geschichte wiederholt sich: Das Emsland zieht heute Ellok-Nostalgiker an. Warum das so ist, lesen Sie hier!
Lokführer im Ruhrgebiet in den 1970ern: Oft um den Kirchturm herum
In den frühen 1970er-Jahren arbeitet Peter Schricker als Lokheizer im Bahnbetriebswerk Duisburg-Wedau. Seine Dampflok-Einsätze sind die typischen jener Jahre:... weiter