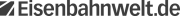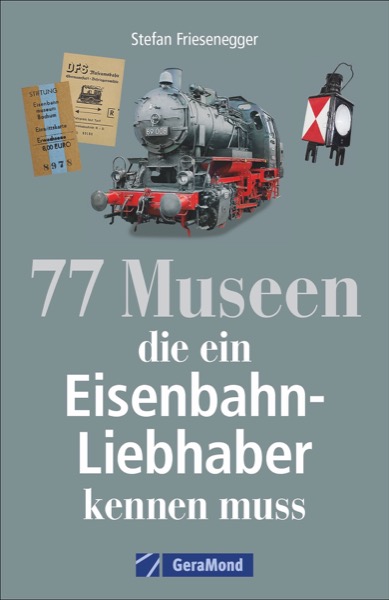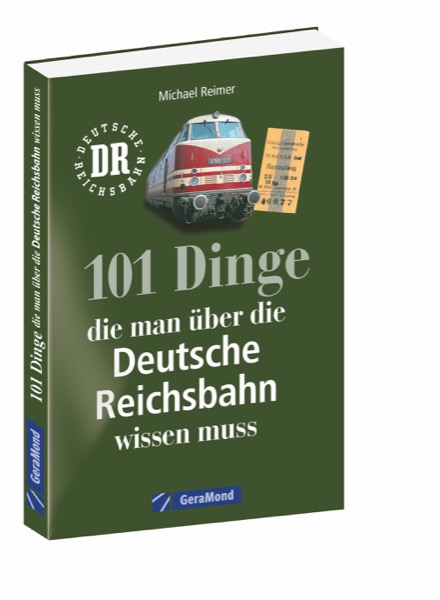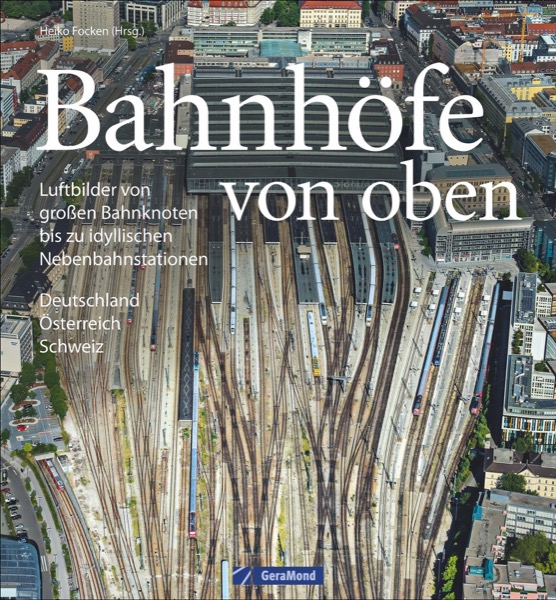Die kleine Universallok
 © Werkfoto Henschel/Slg. H. Brinker
© Werkfoto Henschel/Slg. H. Brinker„94 neu“ Priorität. Realisiert wurden schließlich 105 Loks der Baureihe 23, 18 Exemplare der „93 neu“ wurden als Baureihe 65 in Dienst gestellt und 41 Loks der Baureihe 82 („94 neu“).
Die Planungen zu einer neuen 78er verschwanden in den Schubladen, sollten aber in Form der kleinen Baureihe 66 Wiederauferstehung finden. Geplant war auch eine „64 neu“, die aber keinerlei Priorität genoss. Eine moderne 1’C1’-Tenderlok sollte das werden, doch während 1950/51 der Serienbau der 23, 65 und 82 längst begonnen hatte, wurde an der neuen 64 noch herumkonstruiert. Ein Grundübel der alten 64 ließ sich bei der vorgesehenen Beibehaltung der Achsfolge nicht vermeiden: die zu geringen Wasser- und Kohlenvorräte.
Nachdem sich bei der 65 das hintere Drehgestell gut bewährt hatte, kam man auf die Idee, die „neue 64“ auch so auszustatten: Das Ergebnis der Überlegungen im Fachausschuss aus dem Jahr 1951 war dann eine ganz neue Lok mit der Achsfolge 1’C2’, die mit der 64-Planung nicht mehr viel gemeinsam hatte und die Baureihenbezeichnung 66 erhalten sollte. Parallel hierzu wurde auch eine Baureihe 83 durchkonstruiert, eine leichte 1’D2’ für Nebenbahnen.
Aber nur die von Henschel konstruierte 66 schaffte den Sprung vom Reißbrett auf die Gleise: Im Oktober 1955 wurden 66 001 und 002 an die DB abgeliefert. Die Realisierung des Nebenbahn-Vierkupplers blieb der Deutschen Reichsbahn in der DDR vorbehalten, die immerhin 27 Exemplare der Baureihe 8310 beschaffte.
Zu spät: Universallok der Baureihe 66
Die Baureihe 66 war natürlich nicht mehr als ausschließlicher Ersatz für die Baureihen 64 und 74 vorgesehen, auch die 24 wollte man mit ihr ersetzen, und sogar in die Dienstpläne der viel größeren 3810 und 78 sollte die Lok vordringen. Ermöglicht wurde dies durch die hervorragende Konstruktion der Lok: Mit nur 15 Tonnen Achsdruck konnte sie jede Nebenbahn befahren, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h war sie schnell genug für jede Hauptbahn und durch ihre großen Vorräte war sie flexibel einsetzbar.
Die rund einjährige Erprobung der 66 001 beim BZA Minden bestätigte die guten theoretischen Werte: Trotz einer um 40 Prozent geringeren Kessel-Heizfläche war die neue Lok der 3810 und 78 – beides hervorragende preußische Konstruktionen – leistungsmäßig mehr als ebenbürtig und der alten 64 weit überlegen, und das bei deutlich geringerem Kohlenverbrauch. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h bei nur 1.600 mm großen Treibrädern waren kein Wagnis, durch einen perfekten Massenausgleich lief die Lok auch bei diesem Tempo noch ruhig. Zudem gab es keinerlei Kinderkrankheiten, wie sie bei den ersten Neubau-Dampfloks aus den frühen 1950er-Jahren noch aufgetreten waren.
Die 66 war also serienreif, doch wir schreiben das Jahr 1956: Wirtschaftlich war die Dampflok gegenüber den modernen Traktionsarten ins Hintertreffen geraten: Die Bundesländer beteiligten sich an den großen Elektrifizierungsprogrammen, der Preis für Steinkohle stieg ständig, der Zoll auf Öl-Einfuhren war aufgehoben worden, und dank einer beinahe vorhandenen Vollbeschäftigung schlugen auch die Personalkosten immer mehr zu Buche. Zudem hatte man mit der V 80 bereits die Dieseltraktion im geplanten Einsatzgebiet der 66 erfolgreich erprobt, und auch an der V 100 als verbesserter V 80 wurde bereits kräftig herumkonstruiert. So hatte die 66 keine Chance mehr auf einen Serienbau, so gut sie auch gelungen war …
Seiten
ET 184 41, 42/ ET 185 01: Elektrische Pioniere
Am 4. Dezember 1895 eröffnete die Localbahn AG in Württemberg zwischen Meckenbeuren und Tettnang die erste elektrische Vollbahn in Europa.
Für den...
weiterBaureihe 140 im Emsland: Die Funken schlagen
Im Emsland tummelten sich früher die Dampflokfans. Doch Geschichte wiederholt sich: Das Emsland zieht heute Ellok-Nostalgiker an. Warum das so ist, lesen Sie hier!
Lokführer im Ruhrgebiet in den 1970ern: Oft um den Kirchturm herum
In den frühen 1970er-Jahren arbeitet Peter Schricker als Lokheizer im Bahnbetriebswerk Duisburg-Wedau. Seine Dampflok-Einsätze sind die typischen jener Jahre:... weiter