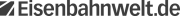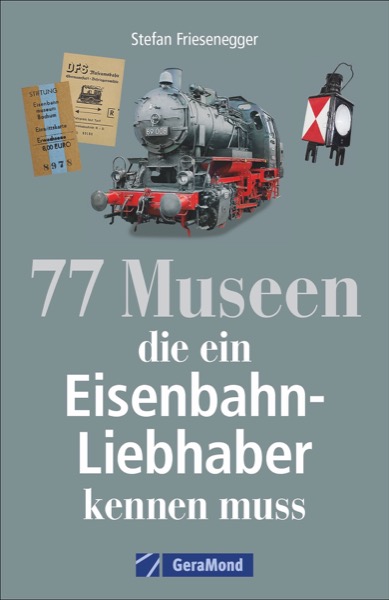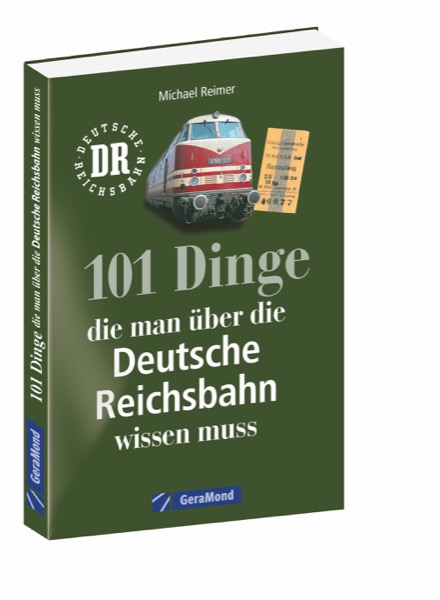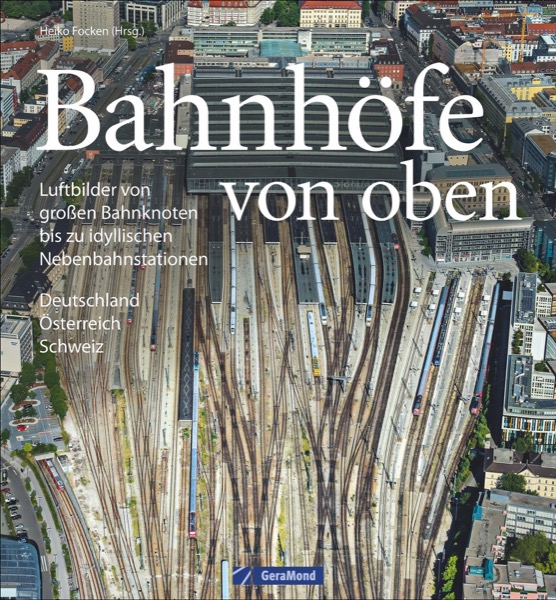Siegeszug der Einmotorigen
 © Lok-Magazin
© Lok-MagazinDie Serie darf schwerer werden
Da an der Maschinenanlage, den Drehgestellen und der übrigen Ausrüstung keine merklichen Kostensenkungen möglich waren, wurde das in Leichtbaukonstruktion ausgeführte Untergestell des Lokkastens durch die Verwendung dickerer Bleche und damit einfacherer Tragstrukturen auf eine kostengünstigere Fertigung abgeändert, wozu auch die Vermeidung der sphärisch gekrümmten und damit aufwendigen Formteile der „Lollo“-Front beitrug.
Zu den Vereinfachungen gehörte auch die Herausnahme der Batteriebehälter aus dem Untergestellrahmen und ihre Unterbringung unter dem Rahmen neben den Brennstoffbehältern, wodurch eine durchgehend gerade Rahmenunterkante erreicht wurde, die sich zusammen mit den nun rechteckig gestalteten Tanks auffallend von den zehn Vorausloks unterscheidet.
Wegen der größeren Einfachheit gegenüber dem mit einer rollengelagerter Kurbelwelle ausgeführten Maybach-Motor MD 870 gab die DB für die Serie dem schwereren Mercedes-Motor MB 839 (später MTU 16 V 652 TB) den Vorzug, der bei einer UIC-Nennleistung von 2.000 PS **) auf eine Gebrauchsdauerleistung von 1.900 PS eingestellt war und für die Traktion eine mittlere Getriebe-Eingangsleistung von 1.770 PS ermöglichte.
Die übrige Ausrüstung entsprach weitgehend der Vorserie. Durch die Änderungen erhöhte sich das durchschnittliche Dienstgewicht (2/3 Vorräte) von 74,5 auf 76,7 Tonnen und erreichte nun bei vollen Vorräten an einigen Radsätzen eine höchste Last von fast 20 Tonnen. Zwischen 1964 und 1967 lieferten Henschel, KHD, Krauss-Maffei, Krupp und MaK 214 Serienausführungen der Baureihe V 160 (216).
Nachdem die V 160 in ihren letzten Einsatzjahren immer mehr in untergeordnete Dienste abgeschoben worden war, endete 2004 ihr Einsatz bei der Deutschen Bahn. Einige Exemplare überlebten bei Privatbahnen oder Baufirmen, wo sie auch heute noch, teilweise mit modernisierter Ausrüstung, z. B mit dem 2.040 PS starken MTU-Motor 12 V 4000 R20 im Einsatz sind. Thomas Feldmann hat im LOK MAGAZIN 8/2013 die sechs durch OnRail umgebauten Exemplare mit der Bezeichnung DH 1504 vorgestellt.
Weiterentwicklungen der V 160
Mit dem Ziel, auch im Dieselbetrieb die Dampfheizung der Reisezüge durch eine elektrische Heizung zu ersetzen, wurden ab 1963 zwei Varianten mit elektrischer Zugenergieversorgung entwickelt, wodurch die Heizkesselanlage und das lästige Mitführen und Betanken von Speisewasser und Heizöl entfallen konnten.
Zur Erzeugung der Heizenergie von mindestens 300 kW durch einen Generator reichten aber die Leistungen der seinerzeit für den Einsatz in vierachsigen Dieselloks geeigneten Dieselmotoren nicht aus. Für den Generatorantrieb wurde ein zusätzliches Antriebsaggregat erforderlich.
Naheliegend war nun die Verwendung eines zweiten Dieselmotors, eine Lösung, die unter der Baureihenbezeichnung V 162 (später 217) von Krupp erarbeitet wurde, während die unkonventionelle Antriebslösung durch eine zusätzliche Gasturbine als V 169 (219) von Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD) entwickelt und gebaut wurde.
Als Ersatz für die nicht vorhandene Heizkesselanlage wurden alle mit einer elektrischen Heizung ausgerüsteten Baureihen für das Motorvorwärmen und Warmhalten des Kühlwassers mit ölgefeuerten Heizeinrichtungen der Bauart Hagenuk oder Webasto ausgerüstet.
Der Heizdiesel stammt aus dem VT 24
1965/66 erschienen dann die drei Prototypen V 162 001 – 003, die für den Generatorantrieb den aus den Triebwagen VT 24 (624) stammenden 500 PS starken 12-Zylinder-Unterflurmotor D 3650 HM 5 der MAN erhielten. Während bei der 001 und 002 der Heizdiesel über dem Generator angeordnet wurde und beide über ein Zwischengetriebe verbunden waren, erwies sich die in der 003 gewählte Lösung mit direkt am Motor angeflanschten Generator als die zweckmäßigste Bauform.
Seiten
ET 184 41, 42/ ET 185 01: Elektrische Pioniere
Am 4. Dezember 1895 eröffnete die Localbahn AG in Württemberg zwischen Meckenbeuren und Tettnang die erste elektrische Vollbahn in Europa.
Für den...
weiterBaureihe 140 im Emsland: Die Funken schlagen
Im Emsland tummelten sich früher die Dampflokfans. Doch Geschichte wiederholt sich: Das Emsland zieht heute Ellok-Nostalgiker an. Warum das so ist, lesen Sie hier!
Lokführer im Ruhrgebiet in den 1970ern: Oft um den Kirchturm herum
In den frühen 1970er-Jahren arbeitet Peter Schricker als Lokheizer im Bahnbetriebswerk Duisburg-Wedau. Seine Dampflok-Einsätze sind die typischen jener Jahre:... weiter